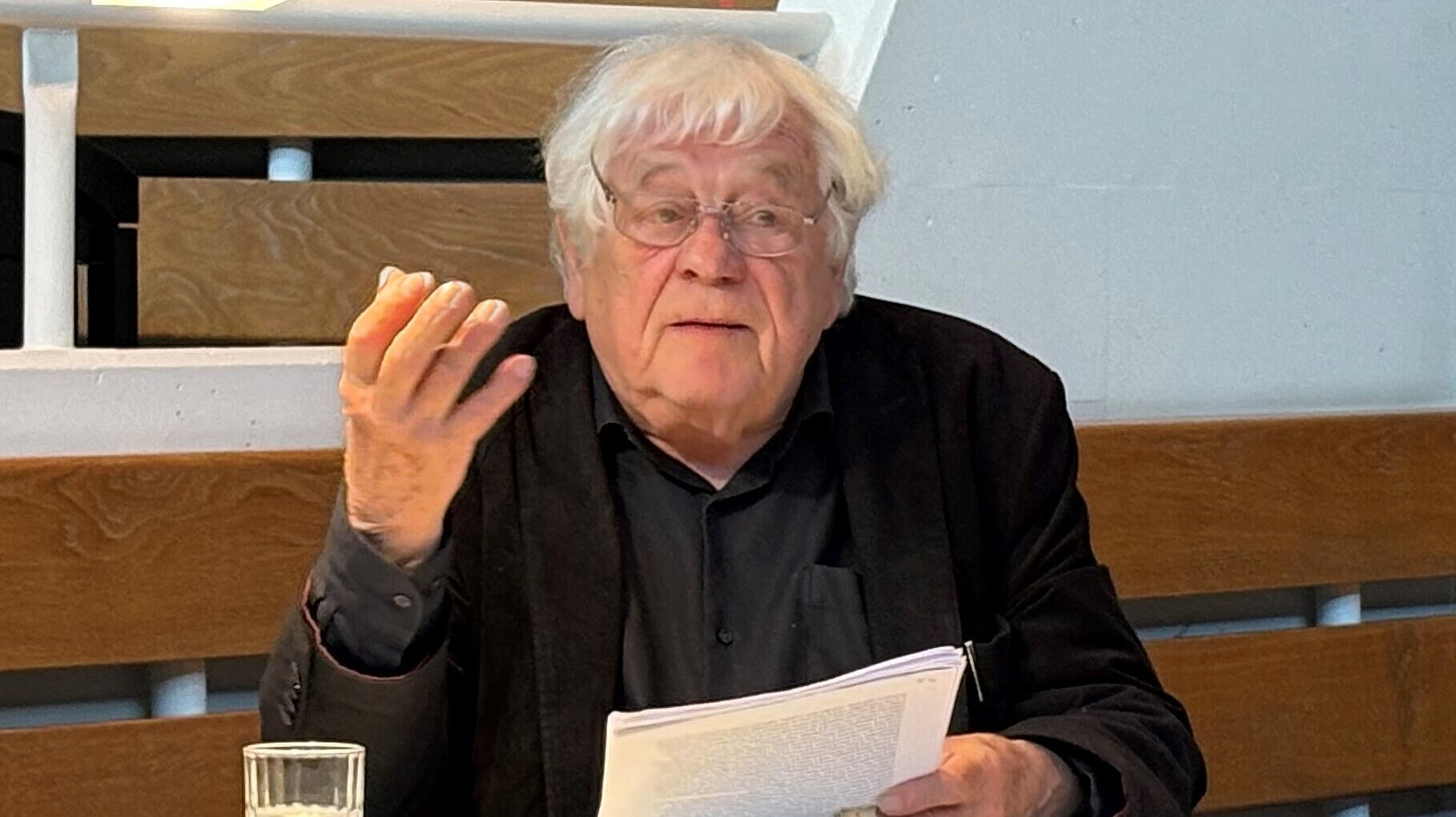Benz hob hervor, dass die Erinnerung an den Holocaust nicht mit dem Verschwinden der Zeitzeugen enden müsse. Die emotionalen Zeugnisse seien zwar unersetzlich, jedoch durch audiovisuelle und schriftliche Dokumentationen dauerhaft zugänglich. Historiker hätten die Aufgabe, historische Zusammenhänge einzuordnen und weiterzugeben – nicht als Konkurrenz zu Zeitzeugen, sondern als notwendige Ergänzung.
Er kritisierte die zunehmende politische Einflussnahme rechtspopulistischer Kräfte, insbesondere der AfD, auf Gedenkstättenarbeit und erinnerungspolitische Institutionen. Diese Partei betreibe eine systematische Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen und versuche, staatliche Förderung für Gedenkprojekte zurückzufahren. Zugleich stellte Benz fest, dass die Nachfrage nach Gedenkstättenbesuchen und historischer Bildung ungebrochen sei – insbesondere durch Schulen.
In der anschließenden Diskussion wurde die Frage nach neuen Formen der Erinnerungsvermittlung aufgeworfen, etwa durch Künstliche Intelligenz oder Virtual Reality. Benz zeigte sich offen für neue Methoden, betonte aber, dass der Kern bleibe: die faktenbasierte historische Aufklärung als Fundament demokratischer Bildung. Erinnerung dürfe nicht zur bloßen Ritualisierung verkommen, sondern müsse immer wieder neu begründet und verteidigt werden.
Benz machte deutlich, dass Erinnerungskultur kein abgeschlossenes Projekt sei, sondern ein dauerhafter, generationenübergreifender Prozess – vor allem angesichts eines wachsenden Antisemitismus, der sich heute in vielfältiger Form äußert. Sein Appell war klar: Wissen, Aufklärung und Empathie sind die zentralen Pfeiler, auf denen eine zukunftsfähige Erinnerungskultur stehen muss.
zurück zur Übersicht